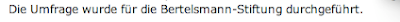… fühlte ich mich auf meinem eigenen Blog nicht mehr allzu wohl. Der ganze Impetus, die Aura, die Attitüde, ja, vielleicht auch das Design, das alles ist nicht mehr so meins. Da fiel mir dieses Blog hier ein. Damals, 2000, eingerichtet, als ich noch keinen Schimmer hatte, was das überhaupt ist, ein Blog. Meine Onlinelektüre reduzierte sich damals vor allem auf die Angebote des Heiseverlags. Ich nehme an, dort einen Link zum damals aufkommenden Bloghoster Blogger.com geklickt zu haben, mir einen Account eingerichtet zu haben, und einfach einen Essay, den ich für die Uni vorbereitete, dort hineingepostet zu haben. Dann wie gehabt. Schlüssel verloren, vergessen, verrottet, bemoost und fünf Jahre später hinter einem Gebüsch wiedergefunden. Die ganze Geschichte, vor allem die des Wiederfindens, könnt ihr HIER nachlesen.
Es wird wirklich Zeit
hier mal wieder was reinzuschreiben. Bloggen ist wichtig, bloggen ist gut, bloggen ist nicht durch Twitter zu ersetzen. Da hat Ralf ganz recht. Und der Gedanke kam mir, weniger gut ausformuliert, auch schon länger von ganz alleine. Ich saß also die letzten 2 Monate des öfteren da und wollte etwas schreiben, nur die Themen versteckten sich und irgendwie…
hallo
Über das Fernsehen…
habe ich für die Blogpiloten einen sehr subjektiven Text verfasst: Warum Fernsehen?
Europa und ich
Danke Irland. Danke, dass ihr den verkorksten Pseudoverfassung ein vorzeitiges Ende bereitet habt. Ich weiß, ihr habt vor allem aus egoistischen Motiven heraus den Vertrag abgelehnt. Das ist Euer gutes Recht. Der Vertrag war nicht gut für Irland, also für Euch.
Marktverwirrung
Da hab ich mich aber Erschrocken bei meiner SpOn-Lektüre: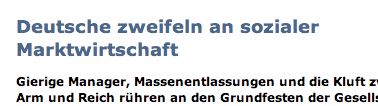
Dann aber die Entwarnung im Text:
Da hat wohl ein Redakteur unsere derzeitige Wirtschaftsordnung mit der „sozialen Marktwirtschaft“ (Gott hab sie seelig) verwechselt. Kann ja passieren.
Profiling mit Twitter, oder was ist ein Captcha?
 (Nein, das hier ist kein Twitkrit)
(Nein, das hier ist kein Twitkrit)
Ist es nicht schön? Man kann es einfach so raushauen. „Ich mache jetzt Feierabend“, schleudert uns Moeffju entgegen. Einfach so. Nix besonderes, eigentlich. Genau diese Art Information, die man bei Twitter einfach so raushaut, ohne sich einen Kopf zu machen. Denn was ist schon dabei? Jeder macht doch Feierabend, irgendwann. Würde man nie drauf kommen, dass das, außer für ein paar Leute, für die es die Möglichkeit eröffnet jetzt mit dieser Person ein Feierabendbier zu trinken, irgendeine Relevanz besitzt.
Und dann kommt irgendwer. Ein zukünftiger unentschlossener Kunde, ein potentieller Arbeitgeber, oder einfach nur eine Profilingagentur. Oder gar eine Web2.0 offene Profilaggregationsplattform. Und Zack wird aus den einzelnen und für sich harmlosen Feierabenden und ihrer Tweetszeitzen ein Arbeitszeitenprofil geschustert.
Es ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Daten wir preisgeben, während wir sie preisgeben. Mit Regelmäßigkeiten und Hashtags lassen sich Daten zu Profilen verknüpfen, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben, welchen Komplexitätsgrad und welche Tiefe sie erreichen können.
Als Kosmar im Artikel bei den Blogpiloten von seinem Geburtstagskalender berichtete, war ich zunächst begeistert.
Ich selbst pflege zum Beispiel gerne den Twitter-Geburtstagskalender mit #hpybdy oder zeichne meinen letzten Tweet des Tages gerne mit #n8 aus.
Ist ja auch eine tolle und ebenso einfache Idee. Dass dort aber Liste für alle Leute zugänglich ist, die das für die Identifizierung ziemlich wichtige Datum des Geburtstags vieler Twitterer einfach so abrufbar macht, ist ein Datenschutzproblem. Ganz besonders dann, wenn man wie ich anonym im Netz unterwegs ist.
Ich weiß selber noch nicht, was das alles für mich und meine Twitterei bedeutet. Ich weiß aber, dass man vorsichtig sein sollte. Vor allem, wenn man anfängt, Dinge zu standardisieren, mit Regelmäßigkeiten und Hashtags aber auch mit dem Gebrauch des Locationtags „L:“. Man kann sich noch etwas schützen, indem man auf die Interpretationsbereitschaft seiner Follower setzt und die Maschinenlesbarkeit reduziert. Man muss im Grunde in Captchas twittern.
Wobei auch das keine Sicherheit ist. Was ein Captcha ist und was nicht, ist eine Frage, die letzten Endes in einer ungewissen Zukunft entschieden wird. Und zwar von Moores Law.
Rinke und lechte Brogs
Frédéric fragt, wo sie denn bleiben, die deutschen Konservativen. Also hier in der Blogosphäre und im gesamten Web 2.0 sind sie irgendwie nicht zu finden. (Wenn man die paar rechtsradikalen Hassblogs gegen den Islam mal außer acht lässt, was ohnehin das Beste ist, was man mit denen anstellen kann.) Jedenfalls wurde mein Kommentar, den ich dort tippte, länger und länger und irgendwann zu lang. Also poste ich ihn lieber hier.
Ich möchte daran erinnern, dass die konservative Blogosphäre in den USA die letzten Jahre sogar stärker war, als die liberale („links“ gibt‘s da ja nicht). Das hat mich anfangs auch gewundert. Partizipation und basisdemokratische Ideen, die ja die Grundpfeiler der Idee des Bloggens sind, sind jedenfalls in Deutschland immer eher linke Werte gewesen.
Aber die USA tickt da eben ganz anders. Demokratie und Meinungsfreiheit – was nebenbei mit einschließt, dass die Meinung eines Einzelnen immer wichtig ist und geäußert werden sollte – ist ein Wert, den dort fast niemand anzweifeln würde, egal wie weit „rechts“ er sich befindet.
In Deutschland hingegen findet man sogar viele „Linke“, die die Legitimität von Blogs glatt in Abrede stellen wollen. Der maulkorbverpassende Richter am berühmten Hamburger Landgericht beispielsweise, wähnt sich selber links. Auch einige Journalisten, die sich sonst offen links positionieren, würden am liebsten eine Lizenz zur Meinungsabgabe fordern, wie man immer mal wieder voller Erschrecken lesen muss. Ich würde also behaupten, dass diese Art der Publizistik von Jedermann auch weiten Teilen der Linken durchaus suspekt ist.
Wenn man sich darüber hinaus die Wahlbeteiligungen bei Plebisziten in Deutschland anschaut, kann man schon daran zweifeln, dass die Meinungsfreiheit hierzulande irgendwas wert ist. Wir sind ja auch ein ziemlich einsames Völkchen mit der Tatsache, nie über unsere Verfassung abgestimmt zu haben. Und die EU-Verfassung wurde uns von Anfang an nie zur Abstimmung angetragen. Ich würde soweit gehen zu behaupten, dass ein Plebiszit zur Verhinderungen einer drohenden Diktatur wegen zu geringer Wahlbeteiligung abgelehnt werden würde. So absurd ist das nicht. Das Plebiszit zur verbindlichen Verankerung von Plebisziten in die Hamburger Verfassung ist letztes Jahr aus eben diesem Grund gescheitert.
Zieht man das alles in Betracht, so muss man zu dem Schluss kommen, dass wir Blogger innerhalb Deutschlands sowas wie Aliens sind. Und ganz erhlich: wenn ich mit einigen Offlinefreunden übers Bloggen rede, komme ich mir auch so vor. Man gerät immer in dem Verdacht sich zu wichtig zu nehmen. Bestenfalls wird es belächelt, was man tut.
Jedenfalls kann man festhalten: Meinungsfreiheit zählt hier zu Lande nicht viel. Nicht mal bei den Linken im allgemeinen, höchstens bei einer bestimmten linken Untergruppe. Wenn überhaupt jemand der Meinung ist, Meinung sei irgendwie wichtig, dann kommt er hierzulande fast ausschließlich aus einem bestimmten links-liberalen Meinungsspektrum, welches in der echten Politik so wenig vertreten ist, dass es fast keine Rolle spielt. (zu „links“ und „liberal“ hat Jens Berger mal einen schönen Artikel geschrieben) Und daraus rekrutiert sich – jedenfalls die politische – Blogosphäre fast ausschließlich.
Was habt ihr denn?
Ich blogge doch! Sogar regelmäßig.
Eigentlich
Was ist „Eigentlich“ eigentlich für ein komisches Wort? Eigentlich scheint es nur im deutschen zu geben. „Really“ im Englischen entspricht ihm nicht wirklich (not really). „Eigentlich“ macht etwas ähnliches, aber es macht es konsequenter. Während „Really“ zwar auf eine Realität hinweist, die anders ist als es scheint, impliziert „Eigentlich“ von vornherein zwei Realitätsebenen. Zwei Realitätsebenen, mit denen wir ganz selbstverständlich umzugehen wissen, die uns sprachlich seit unserer Kindheit begleiten. Die also mit der Muttermilch aufgesogen, uns tief in unser Stammhirn eingepflanzt sind, kaum mehr bewusst aber immer präsent.
Einerseits haben wir die Welt des Scheins. Die Dinge scheinen auf eine bestimmte Art und Weise klar vor uns zu liegen, sie lassen sich beobachten und bewerten, aber der Deutsche weiß bereits, dass dem ja nicht so ist.
Denn eigentlich ist es ja alles ganz anders. Die Welt der Eigentlichkeit ist die Welt der Wahrheit, genauer: der Wahrheit hinter der Wahrheit. Hier, abgetrennt von der äußerlichen Welt, regieren die verborgenen, ja, geheimen Mechanismen der Welt. Das, was nicht offensichtlich ist, hat hier seinen Platz. Das Wort „Eigentlich“ ist das Tor, das man seinem Gesprächspartner dahin öffnet.
Und hinter diesem Tor ist nichts wie es scheint. Hässliche Dinge werden plötzlich schön (Eigentlich ist es doch ganz schön), Aufgaben, an denen man noch sitzt, sind plötzlich erledigt (Eigentlich bin ich schon fertig) und widerliche Menschen werden nett (Eigentlich ist er ganz nett).
Tolles Wort eigentlich, dieses „Eigentlich“.